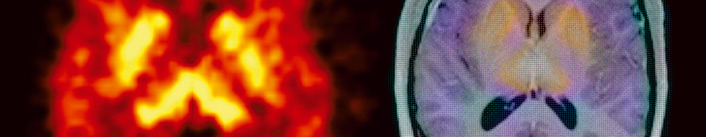Allgemeine Publikationen
Schilddrüse - Ergebnisse der aktuellen klinischen Forschung
Die Folgen von Tschernobyl
Chr. Reiners
Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin der Universität Würzburg
Josef-Schneider-Str. 2, 97080 Würzburg
 (09 31) 2 01 58 68
(09 31) 2 01 58 68
 (09 31) 2 01 22 47
(09 31) 2 01 22 47

Die Folgen von Tschernobyl
Chr. Reiners
Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin der Universität Würzburg
Josef-Schneider-Str. 2, 97080 Würzburg